von Tobias Zimmermann
Geri Thomanns* «Bildungsgeschichten aus der Peripherie» zeigen, wie als schwierig empfundene Ereignisse und Personen oft zentral für sinnstiftende Bildungsarbeit sind: Unerwartete Ereignisse, Misserfolge und der Umgang mit organisationalen Grenzen fordern uns als Lehrende und Führungspersonen an Hochschulen und in anderen Bildungsorganisationen immer wieder heraus. Gerade deshalb sind sie entscheidend für die Weiterentwicklung – von uns als Individuen wie auch der Bildungsorganisationen, in denen wir tätig sind.
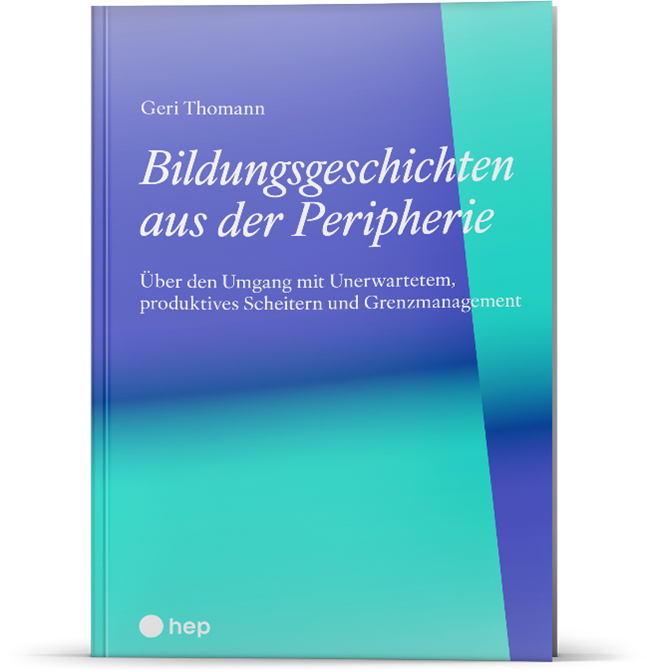
Sie betreten morgens den Seminarraum, schliessen Ihren Laptop an – und stellen fest, dass der Beamer defekt ist. Sie stellen um und beschliessen, mit Whiteboard und Flipchart zu arbeiten, doch als die Glocke läutet, ist der Raum halb leer. Die anwesenden Studierenden berichten Ihnen, dass eine wichtige Bahnlinie unterbrochen sei und deshalb wohl viele Studierende zu spät kommen. Kurz: Es läuft gerade gar nicht nach Plan. Wer Derartiges noch nicht erlebt hat, arbeitet wohl eher in einer Uhrenfabrik als im Bildungswesen.
Geri Thomanns Buch setzt sich intensiv mit der Unplanbarkeit des Bildungsalltags auseinander. Was auf den ersten Blick abschreckend klingen mag, fasziniert den Buchautor als Ausdruck des prallen Lebens. So stehen Unerwartetes, Misserfolge, Grenzen und Randerscheinungen im Zentrum seiner Betrachtungen. In einem Text mit dem Titel «Können Sie scheitern?» fasst Thomann seine Faszination in der ebenso konstruktivistischen wie lebensbejahenden These zusammen, «dass Widersprüchlichkeit alltäglich und somit die Regel ist. Reibungslosigkeit ist hingegen die Ausnahme. Komplexität ist also kein ungewollter Nebeneffekt einer geordneten oder zu ordnenden Welt, sondern die typische Form unserer Lebenswelt.» (S. 121) Damit verbunden betont Thomann auch die Unschärfe von menschlichen Organisationen und zitiert dazu Karl Weick: «An organization is a body of thought, thought by thinking thinkers.»[1] Eine Bildungsorganisation ist so betrachtet ein Konstrukt, das nur insofern existiert, als es laufend von Menschen konstruiert und rekonstruiert wird. Thomann stellt deshalb die Menschen als Konstrukteure ins Zentrum: Er arbeitet heraus, wie sie sie Bildungsorganisationen, Lehren und Lernen durch ihre Handlungen hervorbringen.
Dabei scheint allenthalben das Ideal des «reflective practitioner» auf, das Donald A. Schön mit seinem gleichnamigen Buch geprägt hat. Dieses Konzept beschreibt Fachleute, die durch kontinuierliche Reflexion über ihr Handeln ihre berufliche Praxis verbessern und aus ihren Erfahrungen lernen. Theorie und Praxis inspirieren sich durch reflexive Praxis gegenseitig. Die Idee der reflexiven Praxis wird nicht nur in den «Bildungsgeschichten» mehrfach erwähnt. Sie war für Geri Thomann auch als Führungsperson und Dozent leitend, wie ich in der langjährigen Zusammenarbeit mit ihm erfahren durfte.
Bildung als Abenteuer zwischen Schelmengeschichte und Entwicklungsroman
Die Unschärfe von Bildungsorganisationen, die Unberechenbarkeit von Bildungsprozessen und damit verbundene Scheiterfahrungen betrachtet Geri Thomann aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Das Buch ist dabei eine Collage verschiedenartiger Texte aus den letzten 30 Jahren, die sich um die drei Themen Umgang mit Unerwartetem, produktives Scheitern und die Funktion von Grenzen und Grenzerfahrungen drehen.
Der Autor behandelt die komplexen Themen humorvoll, tiefgründig und mit spürbarer Liebe zum Menschlichen und Allzumenschlichen. Besonders greifbar werden seine Haltung und Denkweise in den elf anekdotischen, pointenreichen Kurztexten: Oft stehen Randfiguren im Zentrum, der Autor hinterfragt den «Common Sense» und auch sich selbst. Die Lesenden dürften dabei nicht selten schmunzeln und gelegentlich gar laut herauslachen, etwa im Text über die «Kübellehrer» (Hinweis: In der Schweiz werden Abfalleimer als «Kübel» bezeichnet, ein «Kübelleerer» ist ein Müllmann; mehr sei hier nicht verraten). In den theoretischen Texten arbeitet Thomann heraus, dass der Umgang mit Randerscheinungen und Grenzerfahrungen mehr als unterhaltsam ist. Vielmehr ist er entscheidend für die Fähigkeit sowohl von einzelnen Menschen als auch von Bildungsorganisationen, Erfahrungen zu integrieren und sich weiterzuentwickeln.
Anhand dieser Beschreibung wird deutlich: Stilistisch bewegt sich das Buch irgendwo zwischen Fachbuch, Erzählsammlung und philosophischem Tagebuch. Das ergibt sich auch aufgrund der unterschiedlichen Textsorten, die es versammelt. Deren Kontexte unterscheiden sich erheblich: Neben den Erfahrungen als Lehrperson in Primarschule, Hochschule und Erwachsenenbildung sowie als Führungsperson in Bildungsorganisationen kommen insbesondere in den Anekdoten auch Erziehungserfahrungen im Umgang mit den eigenen Kindern zur Sprache. Dabei blitzen jedoch immer wieder dieselben Fragen und Phänomene auf, und gerade dies macht das Buch wertvoll: Die zentralen Aspekte werden umso deutlicher sichtbar und ihre Bedeutung der Reflexion zugänglicher, je mehr man sie in verschiedenen Kontexten beobachten kann.
So wirkt die Montage aus Erfahrungsschätzen und theoretischen Betrachtungen erfrischend: Das ganze bunte Chaos, das Lehrende und Bildungsverantwortliche kennen, wird in Szene gesetzt und in Erkenntnisse und Leitfragen verwandelt. So wird beispielsweise aus manch einem Scheitern im Rückblick ein Wegweiser – Thomann spricht von «produktivem Scheitern», dem er den mittleren Buchteil widmet. Die optimistische Grundhaltung, dass wir aus Misserfolgen mehr lernen können als glattgelaufenen Erfolgen, durchzieht das Buch und wirkt ansteckend: Man ertappt sich beim Lesen dabei, mit einem «ja, genau!» zu nicken, weil ein vermeintliches Desaster plötzlich Sinn ergibt. Oder in den von Thomann wiederholt zitierten Worten von Samuel Beckett: «Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.»[2]

Dabei geht es Thomann mehr um das Finden und Gestalten von Sinn als um Erfolg im Sinne von geradliniger Zielerreichung. So gibt er in einer Diplomrede Studienabgänger:innen auf den Weg mit: Für die «Problemlösung werden Rüstzeug, Modelle, Theorien benötigt, über die Sie jetzt ja verfügen. Die gefühlte Schwierigkeit jedoch ist eigentliche Ausgangslage für eine erfolgreiche Verbindung von eigener Erfahrung mit solchen Modellen. Reflexion ist sozusagen eine Transformationshilfe, sie bringt mich eben vom Ende zu einem neuen Anfang, sie kann Weiterentwicklung garantieren. Das kann das Glücksgefühl nach erfolgreichem Tun weniger, wenn es auch wesentlich angenehmer ist und selbstverständlich auch guttut.» (S. 198)
Zwischen Planung und Überraschung: Grenzmanagement als roter Faden
Die «Bildungsgeschichten» handeln vom Navigieren an den Rändern der Planbarkeit. Dazu passt auch der Begriff des Grenzmanagements, der im Zentrum des dritten Buchteils steht. Es dürfte bereits klar geworden sein: Es geht dabei nicht Grenzbeamte, Zölle oder Mauern, sondern um die Kunst, im Bildungsbereich zwischen verschiedenen Welten und Zuständigkeiten hin und her zu wechseln. Thomann zeigt anhand zahlreicher Episoden, wie Lehrende und Bildungsverantwortliche ständig Grenzen managen müssen – die Grenze zwischen Planung und Improvisation, zwischen Erfolg und Scheitern, zwischen dem «Kern» des Curriculums und der «Peripherie» unerwarteter Ereignisse. Komplexität und Überraschungen erscheinen dabei nicht als Bug, sondern als Feature des Systems: Was wie Chaos erscheint, ist in Wirklichkeit normal – und wer in Bildungskontexten arbeitet, tut gut daran, genau damit zu rechnen. Darauf zielt der erste Buchteil, der sich dem Umgang mit Unerwartetem widmet und dabei Improvisation als zentrale Kompetenz herausarbeitet. In den Worten des Autors, in denen das oben erwähnte Ideal des reflektierten Praktikers aufscheint: «Improvisation ist Denken und Handeln in Optionen und hat situativen und prozessorientierten Charakter. Eine Improvisation beinhaltet, die gegebenen Handlungsräume permanent zu hinterfragen, für das Mögliche offen zu sein und Spielräume zu erweitern. Das bedeutet: Improvisation bessert keine gescheiterten Pläne nach. Improvisation ist konstruktiver Umgang mit Unerwartetem und damit eine zentrale Fähigkeit in komplexer werdenden Umwelten. Und: Improvisieren lässt sich üben.» (S. 26)
Zwischenräume als Keimzelle der Erneuerung: Grenzgänger im Third Space
Besonders relevant scheinen mir die «Bildungsgeschichten» für Lesende, die im sogenannten Third Space arbeiten – also in den Zwischenräumen von Lehre, Verwaltung und Entwicklung. An Hochschulen sind dies etwa Studiengangsleitende, Hochschuldidaktiker:innen oder Stabsstellen-Mitarbeitende, in Schulen Schulleitende, Schulsozialarbeitende oder Fachbereichsverantwortliche. Personen mit diesen Aufgaben fungieren als Grenzgänger:innen und Brückenbauende innerhalb ihrer Organisation und zwischen verschiedenen Organisationen. Diese Lesergruppe wird in Thomanns Geschichten viel Vertrautes entdecken, hat der Autor doch selbst jahrzehntelang in und an diesen Schnittstellen gearbeitet. Solche organisationalen Grenzgänger wissen aus eigener Erfahrung: Ein Tag im «Grenzmanagement» verläuft selten ohne Überraschungen. Da meldet sich plötzlich der Praxispartner mit neuen Anforderungen ans Modul, die Prüfungsordnung ändert sich kurz vor der Durchführung oder eine eingeführte didaktische Innovation scheitert im ersten Anlauf grandios (vielleicht auch am Widerstand der Lehrenden). Thomanns Buch hält uns Profis gewissermassen den Spiegel vor – jedoch nicht, um uns eigene Fehler vorzuhalten, sondern um uns das Potenzial im Ungeplanten zu offenbaren.
Essenziell dafür sind Boundary Spanning Roles. Dies sind Rollen, die Brücken zwischen den „Kernen“ und „Peripherien“ von Bildungsorganisationen schlagen: Diese Grenzspäher:innen unserer „Organisationen sind Mitglieder, die sich als Türöffner:innen mit Administration, HR-Prozessen oder Marketing beschäftigen oder (…) an unserer Hochschule Studierende in die Praxis begleiten oder in interinstitutionelle Forschungsprojekte oder in Kooperationen involviert sind (…). Solche Funktionsträger bewegen sich grenzüberschreitend zwischen der Umwelt der Organisation und deren Kern (…); [sie] bewegen sich in verschiedenen Teams, verbinden Kulturen und Wissensbestände, sie dehnen Grenzen (…). Dadurch leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Wissensmanagement und zur Kulturbildung der gesamten Organisation. Auch wenn sie gerade deswegen nicht immer einfach zu führen sind.“ (S. 155) Thomann weist zugleich auf die Herausforderung hin, diese Grenzspähenden angemessen wertzuschätzen und zu pflegen. Denn oft sind es gerade sie, die entscheidende Innovationen entwickeln – und aufgrund ihrer für die Organisation teils unbequemen Rolle oft wenig Anerkennung dafür erhalten.
Fazit: Bewusstseinserweiternde Lektüre
Da Buch liefert keine simplen Patentrezepte (die würden im turbulenten Bildungsalltag ohnehin nicht lange halten), sondern etwas Wertvolleres: eine Haltung der Neugier gegenüber dem Unerwarteten und der Offenheit gegenüber Randerscheinungen. Die Lektüre fühlt sich an, als würde man mit einem klugen, humorvollen Kollegen bei einer Tasse Kaffee über die oft unplanbaren, chaotischen und diffusen Ereignisse an Schulen und Hochschulen sprechen – und dabei langsam begreifen, dass genau die «Peripherie» dieser Institutionen in Wahrheit ihr Herzstück ist. So zeigt das Buch, dass Grenzmanagement auch heisst, die Grenzen des eigenen Denkens immer wieder zu hinterfragen. Nach der Lektüre sieht man chaotische Meetings, gescheiterte Projekte und unerwartete Wendungen nicht mehr unbedingt als Störfaktoren, sondern als Bildungsabenteuer, aus denen der Kern des Lernens erwächst – von einzelnen Menschen und ganzen Organisationen.
In diesem Sinne illustrieren die «Bildungsgeschichten aus der Peripherie» die Anwendung der reflexiven Praxis durch Geri Thomann sowohl auf konkrete Situationen als auch auf komplexe Zusammenhänge. Das Buch ist somit auch als Lehrstück der reflektierten Bildungspraxis hilfreich. Für Personen, die das inspirierende Denken und Handeln von Geri Thomann nicht selbst erleben durften, ist dieses Buch deshalb ein Geschenk. Es wird den Lesenden helfen, künftig die eine oder andere auf den ersten Blick ärgerliche oder besorgniserregende Situation neu zu interpretieren und konstruktive Handlungsoptionen zu entwickeln – etwas, das ich von Geri Thomann persönlich lernen durfte und für mein berufliches und privates Leben von kaum zu überschätzendem Wert ist.
*Geri Thomann ist leider am 15. März 2025 im Alter von 67 Jahren viel zu früh verstorben. Er war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2022 Leiter der Abteilung Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich und hatte eine Professur für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung inne. Von 2007 bis 2024 war er zudem Lehrbeauftragter für Beratungsthemen an der Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).
Als Dozent und Buchautor beschäftigte sich Geri Thomann insbesondere mit den Themen Scheitern in der Führung, Grenzmanagement in Expertenorganisationen, Umgang mit Unerwarteten/Unplanbarem, laterale Führung, didaktisches Handeln in der Weiterbildung und verschiedenen Aspekten von Beratung. Das hier besprochene Buch stellt somit sein letztes Werk dar, dessen Erscheinen er kurz vor seinem Tod noch erleben durfte. Weitere Publikationen von Geri Thomann finden Sie hier.


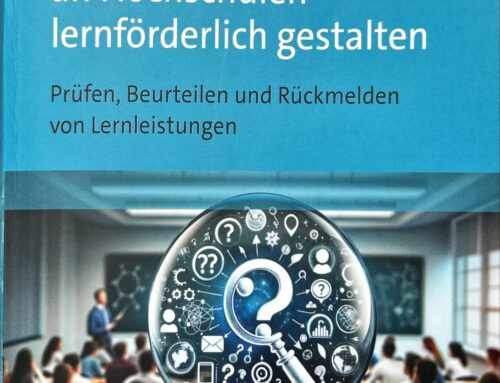


Hinterlasse einen Kommentar